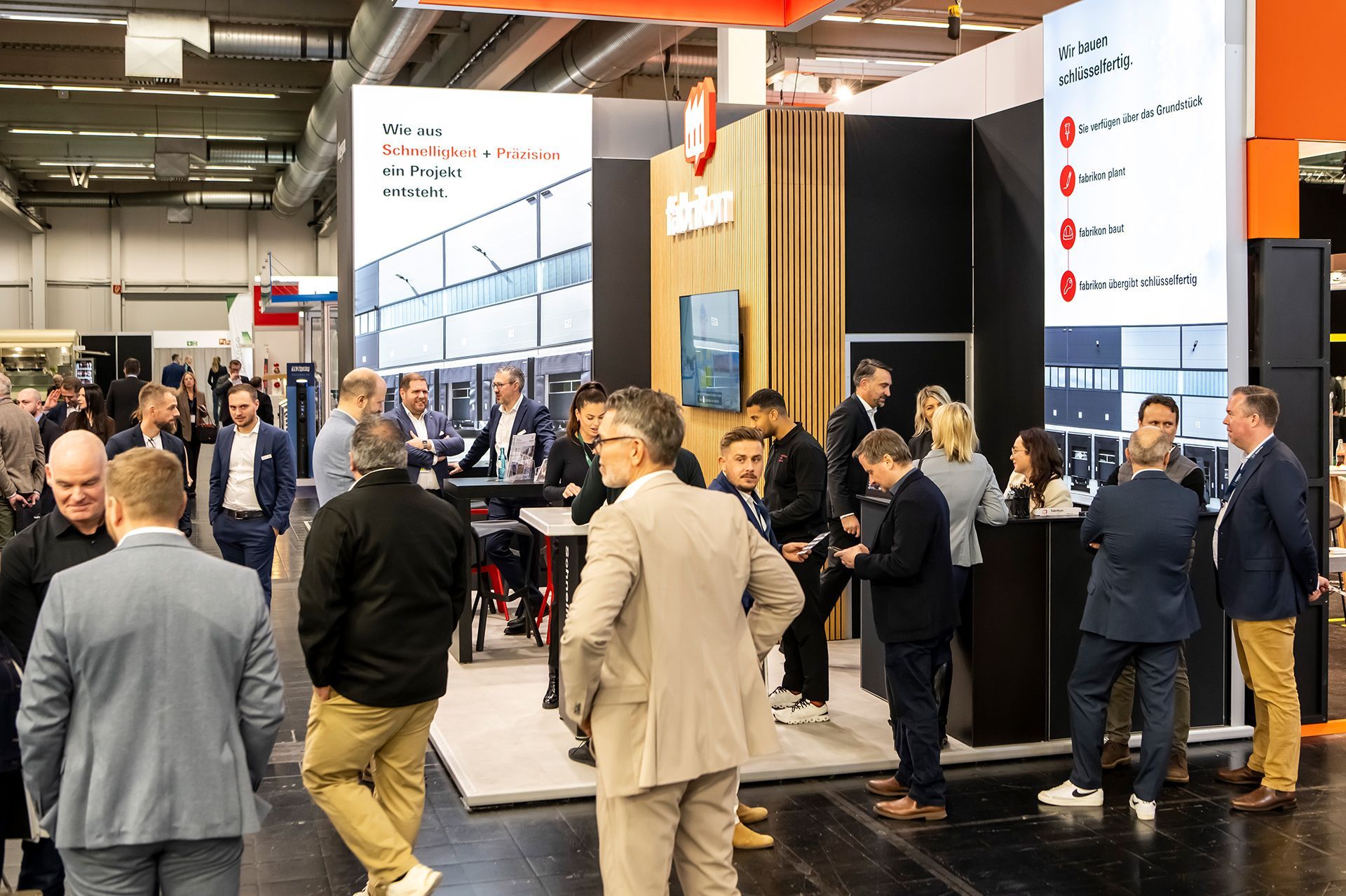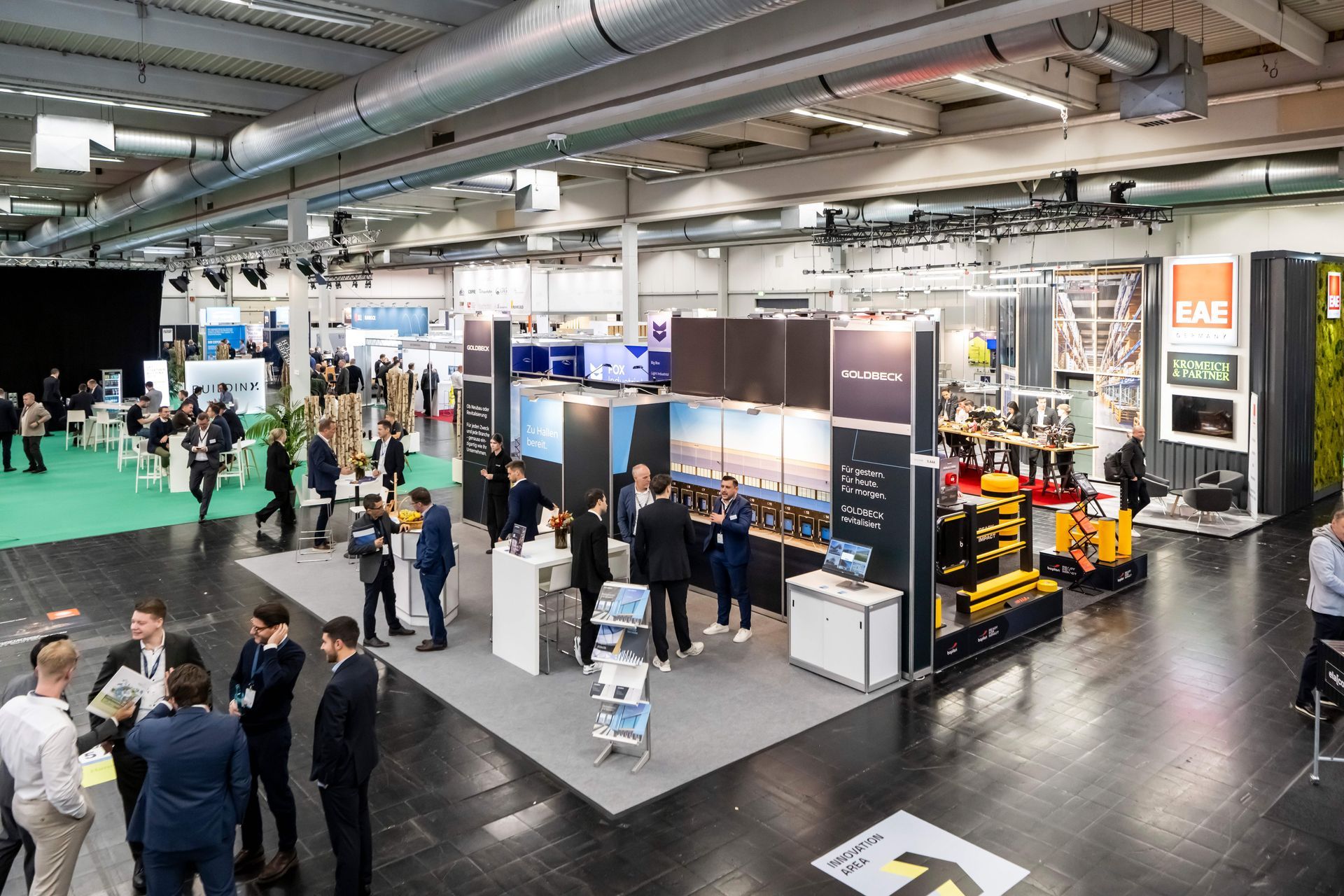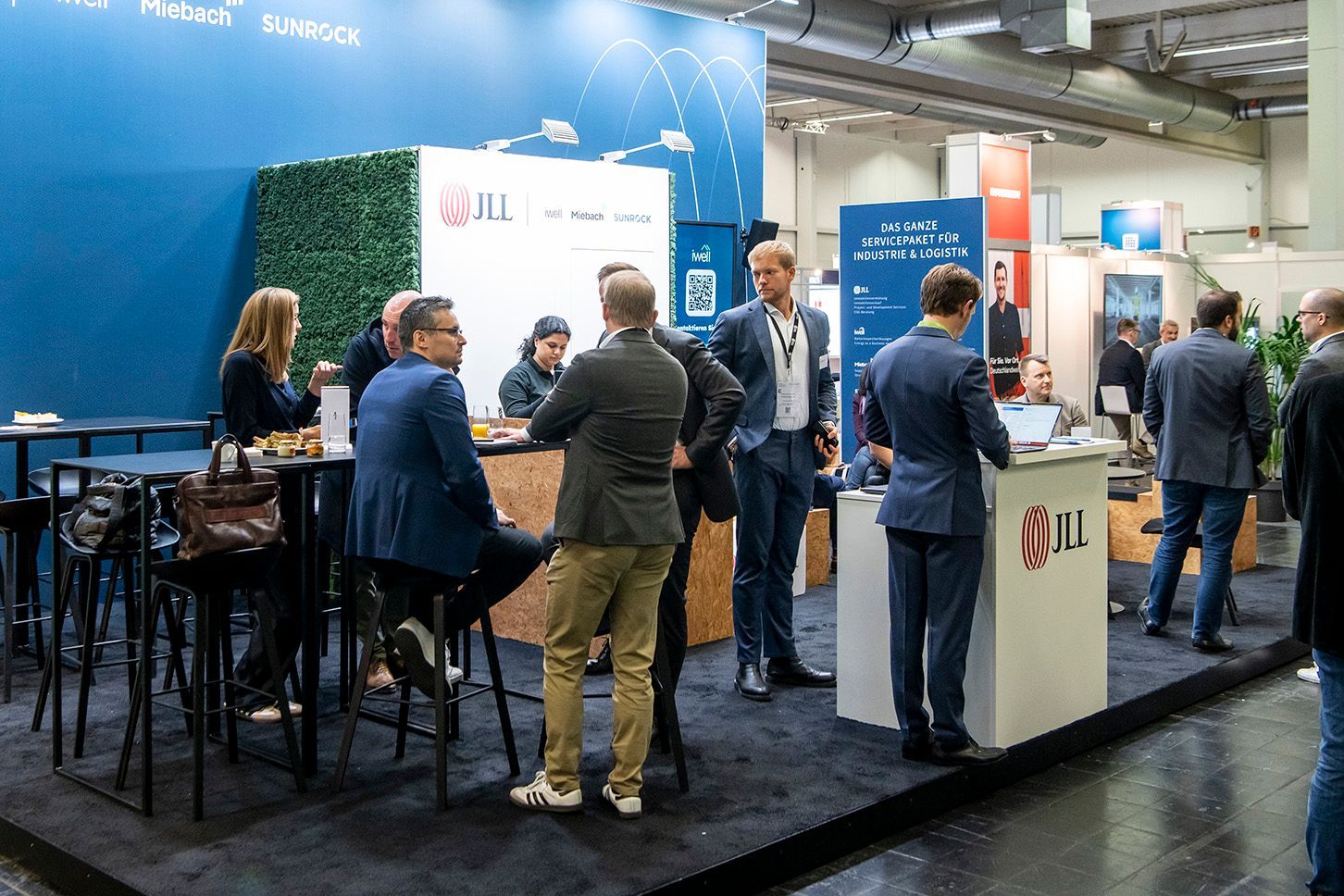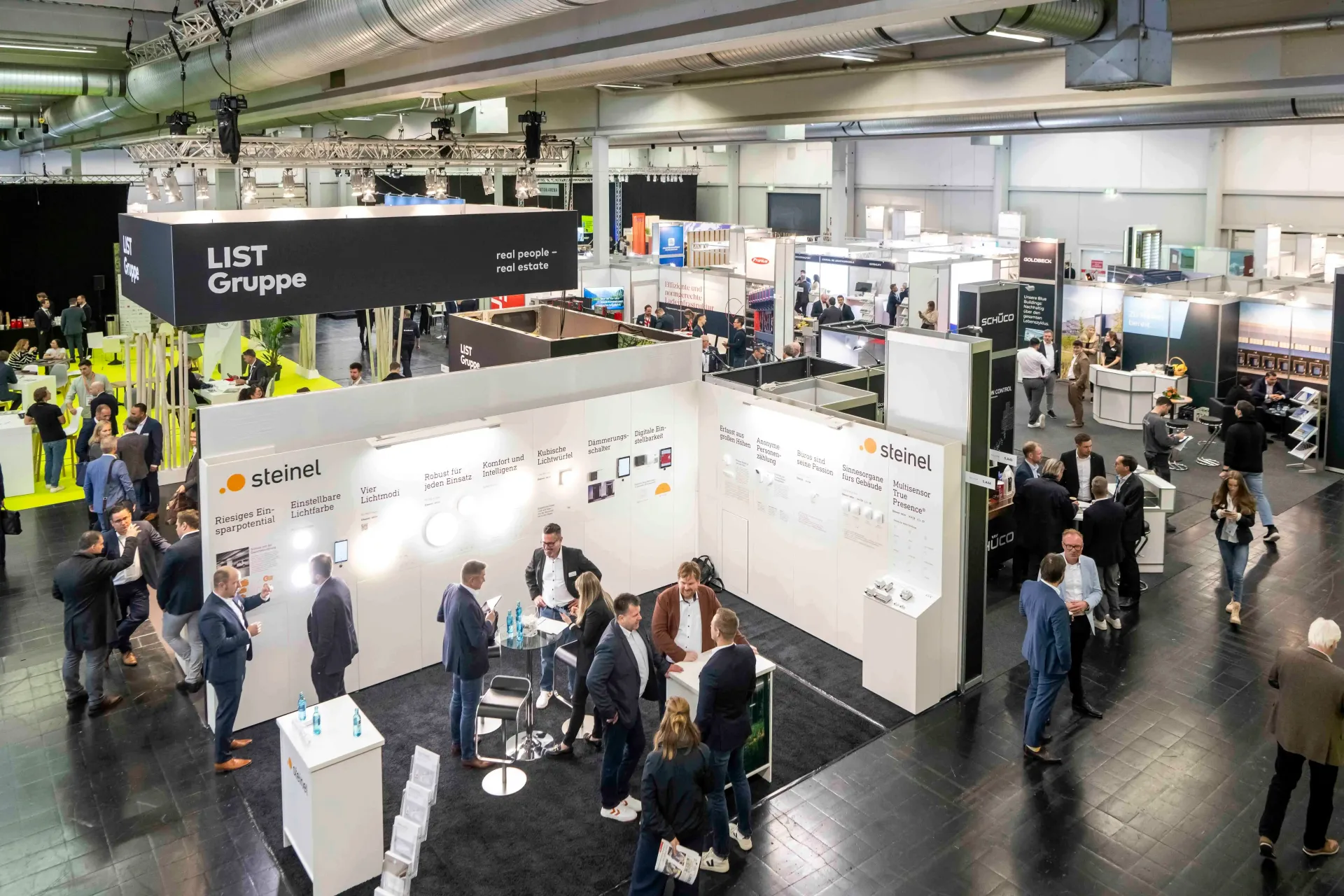Strukturwandel im Ruhrgebiet: von der Industrie- zur Wissensregion
Wo früher Rauchschwaden das Stadtbild prägten, sind es heute grüne Parks. Wer von erfolgreichem regionalem Strukturwandel spricht, kommt am Beispiel Ruhrgebiet nicht vorbei. Bergbauvergangenheit erinnern nur noch die zu Museen und Parks umgewidmeten Anlagen in der Region. Die meisten Menschen hier arbeiten längst im Dienstleistungsbereich.
Das war im Ruhrgebiet, liebevoll „Kohlepott“ genannt, nicht immer der Fall gewesen. Ab dem 18. Jahrhundert wurde dort Kohle gefördert. Die Industrialisierung verstärkte den Einfluss dieses Berufssektors, sodass das Ruhrgebiet zu einem industriellen Ballungsraum wurde. Kohleförderung und stahlverarbeitende Industrie waren lange Zeit die beiden wichtigsten wirtschaftlichen Standbeine der Region, auch nach dem Krieg. Die Kohlekrise brachte jedoch Ende der 1950er Jahre einschneidende Veränderungen mit sich: Die Ruhrkohle war in Deutschland aufgrund von günstigeren Importen und Ersatzprodukten wie Erdöl immer weniger gefragt, im „Pott“ gab es jedoch aufgrund der Monostruktur kaum nennenswerte weitere Industriezweige. Massenentlassungen und Strukturkrisen waren die Folge. Negative Begleiterscheinungen der Monostruktur: Bereiche wie Nahverkehr und Landschaftspflege, Angebote für Freizeitaktivitäten und Bildungsmöglichkeiten wie Universitäten wurden jahrzehntelang vernachlässigt. Der Grund dafür war, dass fast alle Berufstätigen in der Montanindustrie tätig waren – als Forschungsort war das Ruhrgebiet lange Zeit nicht relevant.
Wirtschaftliches Aufholen und ökologisches Umgestalten
Ein erster Schritt in Richtung Strukturwandel begann in den 1960er Jahren mit dem „Entwicklungsprogramm Ruhr 1968-1973“. Maßnahmen zur Umgestaltung des Ruhrgebiets wurden dort festgelegt und umfassten beispielsweise den Ausbau des Verkehrsnetzes, die Schaffung eines höheren Wohnwertes und den Aus- und Aufbau von Schulen und Universitäten.
Sowohl der Wissenssektor – mittlerweile kann das Ruhrgebiet gut 290.000 Studierende an fünf Universitäten, zwei Kunst- und Musikhochschulen sowie 15 weiteren Hochschulen aufweisen – als auch die Gesundheitswirtschaft mit über 330.000 Beschäftigten prägen heute das Tätigkeitsfeld im Ruhrgebiet. Die Bereiche digitale Kommunikation, Logistik und chemische Industrie sind ebenfalls stark gewachsen, 77 Prozent der Beschäftigten üben mittlerweile einen Beruf im Dienstleistungssektor aus. Die einstmals dominierende Monostruktur gehört somit der Vergangenheit an.
Auch landschaftlich hat sich enorm viel getan: Heute gilt das Ruhrgebiet als eine der grünsten Regionen Deutschlands. Das allgemeine Ziel lautete nach dem Ende der Kohleindustrie: Die „schwarze Lunge“ soll wieder atmen können. Hierfür renaturierte man durch die Montanindustrie zersiedelte Flächen und zerstörte Landschaften. So wurden Naherholungsgebiete geschaffen, Parkanlagen errichtet und Grün- und Waldflächen gepflegt. Zu den größten ökologischen Umgestaltungen zählt sicherlich die Renaturierung des Flusses Emscher. Auf einer Fläche von 300 Quadratkilometern entstand eine zusammenhängende grüne Landschaft entlang des Flusses. Dafür war es erforderlich, 429 Kilometer Abwasserkanäle neu zu verlegen. Außerdem wurden vier dezentrale Kläranlagen gebaut. So ist die ehemalige „Kloake“ nun völlig abwasserfrei. Das mehr als 5,5 Milliarden schwere Projekt gilt als eins der größten Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte in Europa.
Das Ruhrgebiet als logistisches Nervensystem
Einige Zeugen der industriellen Ära, die das Aussehen des Ruhrgebiets über 150 Jahre lang geprägt haben, wurden zu Denkmälern oder Schauplätzen für Industriekultur umgebaut, so zum Beispiel die Zeche Zollverein in Essen – mittlerweile Teil des UNESCO Welterbes – oder der Landschaftspark in Duisburg. Auch neuer, grünerer Wohnraum entsteht in diesen Arealen.
Auf einigen ehemaligen Industrieflächen werden zudem neue Gewerbe- und Dienstleistungsparks errichtet. So ist in Oberhausen mit dem Westfield Centro auf dem Gelände eines ehemaligen Hüttenwerkes ein beliebtes Unterhaltungs- und Einkaufszentrum entstanden. In direkter Nachbarschaft: der Gasometer, früher mit der Speicherung von Gicht- oder Hochofengas für die Stahlproduktion betraut. Heute befindet sich in dem 118 Meter hohen Stadtwahrzeichen die höchste Ausstellungshalle Europas – dank der außergewöhnlichen Installationen und Ausstellungsthemen ist der Gasometer als Museum sehr beliebt.
Auch die Logistik hat im Ruhrgebiet nachhaltig Fuß gefasst. Immerhin macht NRW ein Drittel aller Logistikumsätze in Deutschland aus – ein großer Teil davon entfällt auf den „Pott“. Weit über 800 Unternehmen aus diesem Wirtschaftsbereich sind in der Region ansässig, die zusammen 30.000 Menschen beschäftigen. Das hat nicht zuletzt infrastrukturelle Gründe: Das Ruhrgebiet verfügt über zwei internationale Flughäfen, den größten Binnenhafen Europas und das dichteste Straßen- und Schienennetz in Deutschland. Hier sind riesige Logistikflächen wie beispielsweise „Logport I“ in Duisburg-Rheinhausen entstanden. Auf dem ehemaligen Krupp-Werksgelände entstand Ende der 1990er Jahre ein trimodaler Umschlagplatz. Hier werden auf einem 265 Hektar großen Areal Güter zwischen Bahn, LKW auf und Schiffen umgeladen. Zahlreiche führende Logistikdienstleister sind hier angesiedelt, darunter Kühne + Nagel, DB Schenker oder auch DHL. Neben drei weiteren Logport-Standorten in Duisburg, nämlich Wanheim (Logport II), Hohenbudberg (Logport III) und zuletzt Walsum (Logport VI), folgten weitere in Kamp-Lintfort (Logport IV) und Oberhausen (Logport V). Zusammen machen sie eine Fläche von 410 Hektar aus, was fast 580 Fußballfeldern entspricht.
Eine entsprechend hohe Bedeutung haben Logistikimmobilien in der Region: Die Hälfte aller Vertragsabschlüsse über Vermietungen für Neu- und Bestandsflächen in NRW entfällt auf das Ruhrgebiet. Greenfields gibt es praktisch kaum noch, sodass sich Immobilienentwickler voll auf Brownfields konzentrieren, sodass Flächenneuversiegelung auf ein Minimum reduziert werden kann. Ein Beispiel dafür, wie sich dieser Ansatz mit einer weitergedachten Nachhaltigkeit umsetzen lässt, ist die neue Logistikimmobilie im Dorstener Industriepark „Große Heide Wulfen“. Im September übergibt der Immobilienentwickler die 70.000 Quadratmeter große Anlage an Levi Strauss & Co. Das Nutzungskonzept sieht vor, die Immobilie während ihrer Nutzungsdauer CO2-neutral zu betreiben und die verbauten Materialien am Nutzungsende für andere Projekte wiederzuverwenden. Viele der für den Bau benötigten Rohstoffe wurden darum bereits nachhaltig gewonnen und sind unter Berücksichtigung ihrer Recyclingfähigkeit ausgewählt worden.
Die gewaltigen Anstrengungen, die im Ruhrgebiet unternommen wurden, um die Region ökologisch wie wirtschaftlich umzustrukturieren und lebenswert zu machen, haben sich gelohnt und zeigen, dass in puncto Umdenken nahezu nichts unmöglich ist, wenn Beteiligte aus allen Bereichen an einem Strang ziehen.
Autoren: Boris Kretzinger, Franziska Steffes